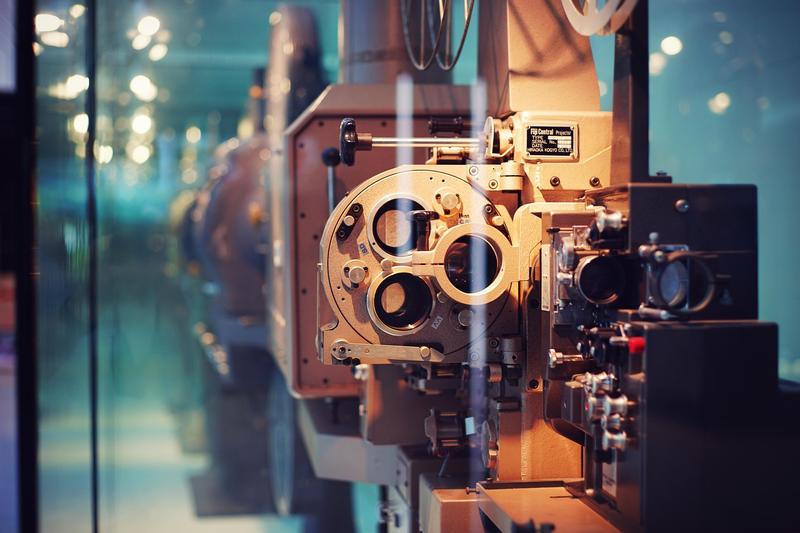Gespräch mit Fatih Akin über seinen Film „Amrum“
Fatih Akin, geboren 1973 in Hamburg, zählt zu den erfolgreichsten Regisseuren Deutschlands. 2004 wurde sein Drama „Gegen die Wand“ mit Sibel Kekilli mit einem Goldenen Bären, dem Deutschen und dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. 2007 erhielt „Auf der anderen Seite“ in Cannes den Preis für das beste Drehbuch. Mit „Aus dem Nichts“ legte Fatih Akin 2017 seinen bislang größten Erfolg vor. Das Drama um einen Neonazi-Anschlag gewann den Golden Globe und den Deutschen Filmpreis. Diane Kruger bekam in Cannes die Goldene Palme. Nach dem Serienkiller-Drama „Der Goldene Handschuh“ folgt nun „Amrum“, die Kindheitserinnerungen von Hark Bohm an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit dem Regisseur unterhielt sich unser Mitarbeiter Dieter Oßwald.
Doppelpunkt: Herr Akin, der junge Held im Film will unbedingt Weißbrot mit Butter und Honig besorgen. Gilt diese Einfachheit auch für den Film selbst?
Akin: Dass der Film so einfach wie ein Weißbrot mit Butter und Honig sein sollte – das kam eigentlich von Laura Tonke. Als sie es sagte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich hatte ursprünglich andere filmische Vorbilder im Kopf, auch eine andere visuelle Haltung. Ich wollte zum Beispiel die Kamera auf eine bestimmte Weise einsetzen, mehr in Richtung Terrence Malick, eher episch, poetisch. Aber als Laura das sagte, wusste ich: Das muss werden wie A Summer Day von Edward Yang – der einfachste Film, den ich kenne, und einer der intensivsten. Seine Kraft kommt aus der Reduktion, wie Bruce Lee! Ich hatte ja von Anfang an zu Hark gesagt: Das ist Fahrraddiebe und Schuhputzer (beide von De Sica), das lebt von der Einfachheit. Man kann das große Ganze im Kleinen erzählen. Aber natürlich wächst im Laufe des Prozesses alles– wird größer, komplizierter.
Doppelpunkt: Glauben Sie, dass das ein Trend ist – das Erzählen in der Reduktion?
Akin: Ob das jetzt ein Trend ist, weiß ich nicht. Aber es gibt immer wieder Filme, die aus dieser Einfachheit ihre Kraft beziehen. Für uns Europäer ist das eigentlich die sinnvollere Art, Filme zu machen, weil wir eben nicht die Budgets haben wie unsere transatlantischen Kollegen. Und wenn man sich Werke von Bergman oder Östlund anschaut, sieht man: Das hat es immer gegeben und wird es immer geben. Diese Art des Erzählens hat einfach Bestand. Auch weil sie wahrhaftiger ist.
Doppelpunkt: Ein bisschen Terrence Malick ist aber doch drin – jedenfalls beim Licht.
Akin: Ja, beim Licht. Ich durfte wegen der schauspielenden Kinder nur drei Stunden am Tag drehen, konnte mir die Zeitfenster aber aussuchen. Ich habe gesagt: Lasst mich bitte nicht um acht Uhr morgens am Set rumstehen und dann um zwölf bei steiler Sonne irgendeinen Mist drehen. Lasst uns lieber um halb drei anfangen zu proben, um sieben Uhr abends kommen die Schauspieler, und wir drehen bis zehn. Das war dann die gute blaue Stunde nach dem weichen Gegenlicht. In Dänemark hat’s tagsüber geregnet, abends kam dann die Sonne raus. Das hat natürlich auch atmosphärisch eine Funktion. Und ja, ich hatte viele Vorbilder im Kopf, aber eben nicht diese flirrende, somnambule Kamerabewegungen, wie sie Malick benutzt.
Doppelpunkt: Die Dynamik unter den Kindern erinnert an „Stand by Me“. War das ein Vorbild?
Akin: Ja, absolut. Stand by Me ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, und ein echtes Vorbild für diesen Film. Was die Amerikaner da können – dass Kinder als Protagonisten funktionieren und es trotzdem auch ein Film für Erwachsene ist – das finde ich großartig. Ich weiß nicht, ob das bei mir auch so aufgeht, ich glaube, mein Film ist eher etwas für Erwachsene. Aber ich wollte den Kindern auch etwas geben, was sie anspricht. Alles, was ein bisschen gruselig ist, was Splatter ist, was sie herausfordert – das ist für die Kids im Publikum.
Doppelpunkt: Man könnte es auch als kleine Hommage an Tarantino verstehen, der ja ein Fan von Ihnen ist – wie auch umgekehrt.
Akin: Nein, das war keine Tarantino-Hommage. Und die Kaninchen-Szene auch keine an Pusher III von Nicolas Winding Refn. Es stand so im Drehbuch. Ich dachte einfach, das muss man so drehen, wie’s da steht. Man muss sehen, wo das Fleisch herkommt, das wir heutzutage nur aus dem Supermarkt kennen. Es war mir wichtig, das zu zeigen – und auch, dass das abstößt. Meine Tochter hat die Szene in Cannes gesehen und war verärgert. Und Diane Kruger sagte zu mir: Es ist gut, dass sie das ablehnt. Es zeigt, dass sie nicht abgestumpft ist. Das fand ich richtig.
Doppelpunkt: Wie ist es mit Diane Kruger und Matthias Schweighöfer – sind die im Film, damit die Finanziers zustimmen?
Akin: Also, das erste Mal, dass ich mit einem internationalen Star gearbeitet habe, war mit Diane bei “Aus dem Nichts“. Davor hatte ich auch bekannte Leute, klar, aber “Aus dem Nichts“ hat Türen geöffnet, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Auf einmal war ich in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Heute ist das leider so: Wenn ein Film nicht schon am ersten Wochenende seine Zahlen macht, fliegt er aus dem Kino. Die Zeiten, in denen sich ein Film über Wochen entwickeln konnte, sind vorbei.
Doppelpunkt: Wie ist die Arbeit mit Stars?
Akin: Diane ist eine fantastische Schauspielerin, mit der ich mich super verstehe. Wir haben uns wirklich gesucht und gefunden. Ich könnte jeden Film mit ihr machen. Es fühlt sich an wie in einer Band: Ich bin der Bassist, sie ist das Schlagzeug – oder ich bin Schlagzeug und sie singt. Jedenfalls: Es groovt. Und ja, sie ist berühmt – aber für sie bin ich so eine Art-House-Typ, der sie herausfordert. Und mit Matthias? Wir kannten uns lange, aber haben jetzt zum ersten Mal zusammengearbeitet. Er will sich neu erfinden, andere Sachen machen. Und ich finde es spannend, populäre Leute aus ihrem gewohnten Umfeld zu holen. So wie die Safdie-Brüder das mit Adam Sandler gemacht haben in Uncut Gems: Der Clown der Nation spielt plötzlich in einem der härtesten Autorenfilme der letzten Jahre. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
Doppelpunkt: Sie haben mal gesagt, „Gegen die Wand“ sei ein Pickel gewesen, den Sie ausdrücken mussten. Gilt das heute noch?
Akin: Ja, das Bild stimmt noch. Aber ich bin nicht mehr in der Pubertät. Ich habe einfach weniger Pickel. Gestern hatte ich einen über der Lippe – vielleicht Stress. Aber ich will ja nicht warten bis ich einen Pickel habe, um einen Film zu drehen. Ich will regelmäßig drehen – und dann muss ich manchmal aus anderen Gründen arbeiten. Aber wenn ein Pickel kommt – dann weiß ich jetzt besser, wie ich ihn ausdrücke.
Doppelpunkt: Sie sagten, “Amrum“ sei eine Reise in die Tiefe Ihrer deutschen Seele. Wie meinen Sie das?
Akin: Ich weiß ja selbst nicht immer, was das ist – deutsch zu sein. Bin ich deutsch? Das sagt sich so leicht. Aber dann gibt es Leute, die sagen: Deutsch ist nur, wer deutsches Blut hat. Und das werden immer mehr. Der Film beschäftigt sich mit einer sehr deutschen, sehr weißen „Alman“-Thematik, mit der ich mich vorher nie wirklich auseinandergesetzt habe. Ich wollte sie präzise erzählen, ohne Klischee. Und auf dem Weg dorthin habe ich gemerkt: Da ist eine deutsche Seele in mir. Ich bin auf ein Goethe-Zitat gestoßen: „Wo wir uns bilden, da ist unser Vaterland.“ Und ich habe meine wichtigste Bildung hier erhalten: meine filmische. Also, wenn das stimmt, was Goethe sagt, dann habe ich hier ein Vaterland.
Doppelpunkt: Was ist das nächste Projekt? „Geister weinen nicht“?
Akin: Es heißt nur noch Geister. „Geister weinen nicht“ klang mir zu sehr nach Und Jimmy ging zum Regenbogen. Es ist kein Pickel-Film, aber ich habe mein Thema gefunden. Ich bin mitten in der Arbeit und merke: Ich habe das unterschätzt. Es ist sehr ambitioniert, sehr schwierig, auch wenn’s nicht historisch ist und komplett in Hamburg spielt. Ich dachte, das wird easy – aber Pustekuchen. Einfachheit funktioniert hier nicht. Also kein Brot-Butter-Honig-Film diesmal.
Dieter Oßwald